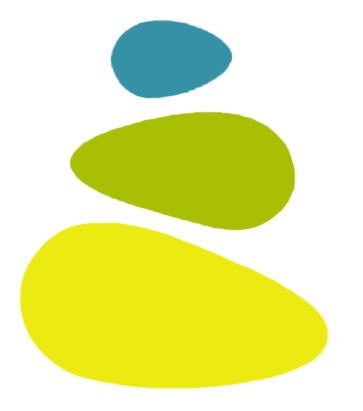
Dr. med. Stefan Kley
Facharzt für Neurologie
Spezialambulanz für Long-COVID und andere
post-akutinfektiöse Syndrome sowie ME/CFS
Seit Herbst 2021 beschäftige ich mich intensiv mit Long COVID und dem Chronic Fatigue Syndrom. An meiner klinischen Arbeitsstelle habe ich ein Programm zur Rehabilitation von Menschen mit diesen und ähnlichen postinfektiösen Syndromen entwickelt, das laufend an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst wird.
Für viele Betroffene besteht aber im ambulanten Bereich weiterhin eine Versorgungslücke. Hier biete ich eine umfassende Beratung und Behandlung in Bad Griesbach im Rottal an.
Long COVID
Ein post-akutinfektiöses Syndrom
Long COVID ist ein Syndrom – also eine Kombination bestimmter Symptome und Beschwerden –, das in Folge einer vom Organismus nicht vollständig bewältigten Infektion mit SARS-CoV-2 auftritt. Dabei können sich neue Unverträglichkeitsreaktionen entwickeln, Fehlregulationen des vegetativen (autonomen) Nervensystems und des Kreislaufs, eine veränderte Zusammensetzung der Darmflora sowie Gerinnungsstörungen mit Beeinträchtigung des Gasaustauschs in den Organen. Es kann zu Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen kommen, zu Störungen der geistigen Leistungsfähigkeit, zu Schlafstörungen und zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. Bisweilen tritt auch körperliche und/oder kognitive „Fatigue“ auf, ein über eine situative Müdigkeit hinausgehendes, durch übliche Erholungs- und Ruhephasen nicht unmittelbar behobenes Gefühl einer reduzierten Leistungsfähigkeit und erhöhten Erschöpfbarkeit. Wenn diese schon nach minimaler, früher problemlos tolerierter körperlicher oder geistiger Anstrengung zu beobachten ist und mit einer Verschlechterung weiterer Symptome einhergeht, liegt möglicherweise eine "post-exertionelle Malaise“ (PEM) bzw. "post-exertionelle neuroimmune Erschöpfung" (PENE) vor, das wesentliche Kriterium des Chronic Fatigue Syndroms (ME/CFS, dazu weiter unten mehr).
Die genannten Symptome sind allerdings nicht spezifisch für Long COVID. Sie können in ähnlicher Form auch als Spätfolge von Infektionen mit Epstein-Barr- und FSME-Viren, Borrelien, Chikungunya-, Dengue- und West-Nil-Viren und anderen Erregern auftreten. Von all diesen post-akutinfektiösen Syndromen (PAIS) ist Long COVID also nur das derzeit bekannteste. Und auch ohne einen Erreger treten ähnliche Krankheitsbilder auf: Die Symptomatik hat deutliche Überschneidungen mit der Fibromyalgie, der „multiple chemical sensitivity“ und der bei US-amerikanischen Armeeveteranen bekannten „gulf war illness“.
ME/CFS
Umstritten, missverstanden und lange vernachlässigt
Die Abkürzung ME/CFS steht für Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue Syndrom. Charakteristisch sind langanhaltende und die Lebensführung stark beeinträchtigende Symptome wie chronische Fatigue, eine beanspruchungsbedingte Symptomverschlechterung (PEM/PENE, s.o.), kognitive Störungen („brain fog“), nicht-erholsamer Schlaf und eine autonome Dysregulation, meist im Sinne einer orthostatischen Intoleranz oder einer Posturalen Orthostatischen Tachycardie (POTS). Des Weiteren bestehen bei ME/CFS häufig Gliederschmerzen, Hypervigilanz und eine ineffektive Ausgrenzung sensorischer Reize mit oft ausgeprägter Überempfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen. Die Diagnose ME/CFS wird klinisch gestellt anhand der Kanadischen bzw. Internationalen Consensus Criteria von 2003/2011 (Carruthers et al., 2011) oder der 2015 aktualisierten Kriterien der National Academy of Medicine (vgl. Bateman et al., 2021).
ME/CFS ist eine komplexe, chronische Erkrankung, in deren Entstehung zahlreiche Faktoren zusammenwirken. Genomweite Assoziationsuntersuchungen im Rahmen des Decode ME Forschungsprojekts zeigen, dass es eine ganze Reihe genetischer Varianten gibt, die prädisponierend für ME/CFS sind, und u. a. Einfluss haben auf die Entwicklung des Nervensystems, den Energiehaushalt, die Regulation von Entzündungsvorgängen und die Bedingungen der Vermehrung von Viren im menschlichen Körper (Ponting et al., 2025).
Um die korrekte Bezeichnung, aber auch um die richtige fachliche Zuordnung von ME/CFS wurden oft vehemente Diskussionen geführt. Der Begriff „benign myalgic encephalomyelitis“ wurde 1956 erstmals und rein deskriptiv, aus eher neurologischer Betrachtungsweise, für die Symptomatik verwendet, die im Zuge der letzten Poliomyelitis-Epidemie bei Pflegepersonal in einem Britischen Krankenhaus aufgetreten war. Der Begriff „Chronic Fatigue Syndrom“ wurde ab den 1980er Jahren in einem psychiatrischen Umfeld definiert und operationalisiert, um weitere Forschung zu diesem Beschwerdebild betreiben zu können. Ob eine Enzephalomyelitis im klassischen Sinne vorliegt, ist nicht gesichert, und ein myalgisches, also von Muskelschmerzen geprägtes Bild ist zwar häufig, aber nicht immer zu beobachten. Die deutschsprachigen Begriffe des Chronischen „Erschöpfungs“- oder „Müdigkeits“-Syndroms können zu einer Bagatellisierung der Erkrankung verleiten und verkennen, dass Müdigkeit, Fatigue und erst recht das Kernkriterium PEM des CFS unterschiedliche Phänomene bezeichnen. Eine neuere Bezeichnung als „systemic exertion intolerance disease“ (SEID) hat sich nicht durchgesetzt, gibt aber die auch für die Differentialdiagnostik entscheidende pathologische Reaktion auf Belastungen gut wieder.
Die Grabenkämpfe, die es gerade bei ME/CFS häufig gibt zwischen somatischen und psychischen bzw. psychosomatischen Erklärungsmodellen, sind völlig abwegig. Körper und Psyche sind zwei Seiten derselben Medaille. Wenn wir so tun, als existierten Körper und Psyche in getrennten Welten, und ME/CFS müsste entweder organisch oder psychisch einzuordnen und zu behandeln sein, dann stellen wir uns ein Bein und tun uns schwer, uns über die Erkrankung überhaupt zu verständigen.

Die belastendsten Symptome bei ME/CFS- und Long-COVID-Patienten
Abbildung aus Eckey et al., 2025; doi: 10.1073/pnas.2426874122
Long COVID und ME/CFS
Was haben sie gemeinsam?
Sowohl Long COVID als auch ME/CFS sind keine eindeutigen, mit bestimmten Biomarkern unstrittig belegbare Krankheitsentitäten, sondern Syndromdiagnosen: diagnostische „Schubladen“ mit relativ weit gefassten Beschreibungen „typischer“ Symptome und Bedingungen, die zum Teil überlappen. Wie alle PAIS kann Long COVID sehr unterschiedliche Ausprägungen annehmen, von denen ein Teil auch die diagnostischen Kriterien von ME/CFS erfüllen. Ein Mensch kann also beides haben, Long COVID und ME/CFS – wobei er oder sie dann nicht an zwei Erkrankungen nebeneinander leidet, sondern Beschwerden aufweist, die eben sowohl als Long COVID als auch als ME/CFS klassifiziert werden können. Bei diesen Menschen sind beide Beschreibungen richtig; erstere sagt eher etwas über den Auslöser der Beschwerden aus, und letztere über deren Ausprägung.
Die Pathomechanismen
Ideen zur Entstehung von Long COVID
Zur Entstehung von Long COVID werden drei wesentliche Pathomechanismen diskutiert (Greenhalgh et al. 2024), die nebeneinander bestehen können und sicher nicht bei jedem Menschen gleich schwer ins Gewicht fallen:
-
Der erste betrifft virusbedingte Vorgänge, zu denen ein anhaltendes Vorhandensein von SARS-CoV-2 oder seiner Komponenten in Körpergeweben gehört, sowie die Reaktivierung von nach früheren Infektionen (erwartungsgemäß!) im Körper verbliebenen Epstein-Barr- und anderen Herpesviren. Diese Vorgänge können zu direkten Schäden an den Zielgeweben und -organen führen.
-
Die zweite Gruppe umfasst immunologische und entzündliche Mechanismen, zu denen eine fehlregulierte Immunreaktion (z.B. dauerhaft aktivierte oder erschöpfte T-Helferzellen, vermehrte zytotoxische T-Zellen, gestörte Homöostase der Zytokine, aktivierte zerebrale Mikroglia) und die daraus resultierende Immunpathologie gehören, die umliegendes Gewebe schädigt, oder Autoimmunität mit ihren Folgen.
-
Die dritte Gruppe umfasst Entzündungen der Innenwände von Blutgefäßen und die durch immunologische Vorgänge ausgelöste Bildung von Blutgerinnseln.
Aus diesen Mechanismen können folgende sekundäre Phänomene abgeleitet werden:
-
eine anhaltende Aktivierung des Komplementsystems (Baillie et al., 2023; Cervia-Hasler et al., 2024) mit Gewebeschäden durch anhaltende Entzündungen,
-
eine beschleunigte Gefäßalterung, v. a. bei Frauen (Bruno et al., 2025)
-
Störungen der Darmflora (Zuo et al., 2020; Giannos und Prokopidis, 2022) und ein Mastzell-Aktivierungs-Syndrom,
-
eine anhaltende Aktivierung des Tryptophan-Kynurenin-Stoffwechselwegs mit der Konsequenz eines gestörten Verhältnisses zwischen neurotoxischen (Chinolinsäure, 3-Hydroxykynurenin) und neuroprotektiven (Kynurensäure, Picolinsäure und NAD+) Tryptophan-Metaboliten sowie einer verminderten Verfügbarkeit von Tryptophan für die Synthese von Serotonin und Melatonin (Cervenka et al., 2017; Chilosi et al., 2022; Rus et al., 2023; Bravi et al., 2025; Ahlberg Weidenfors et al., 2025)
-
Störungen der mitochondrialen Funktion (Guarnieri et al., 2023, Dirajlal-Fargo et al., 2024).
Die Rolle des Immunsystems
Nervensystem und Immunsystem beeinflussen sich gegenseitig
In einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) vom 22. Juli 2025 heißt es zum aktuellen Forschungsstand bei ME/CFS: „Angesichts der bisherigen Erkenntnisse ist derzeit nicht davon auszugehen, dass immunologische Faktoren eine entscheidende Rolle bei ME/CFS spielen.“ Die DGN definiert allerdings nicht, was mit „entscheidend“ gemeint sei.
Tatsächlich finden sich bei ME/CFS sowie auch bei Long COVID, den anderen PAIS und auch den unabhängig von Infektionen auftretenden chronischen Krankheitszuständen sehr viele Hinweise auf Störungen im Immunsystem. So kann beispielsweise die Persistenz und Reaktivierung von EBV durch eine ineffektive Immunabwehr begünstigt werden. Hier gibt es Hinweise auf eine genetische Prädisposition in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des menschlichen Leukozytenantigens (HLA), das auch von Bedeutung ist für das Risiko, als Spätfolge einer EBV-Infektion an Multipler Sklerose zu erkranken, oder eine chronische Verlaufsform einer Borreliose zu erleiden (Drosu et al. 2024, James und Georgopoulos 2022, Ruiz-Pablos et al. 2023). Verschiedene HLA-„Haplotypen“ haben wesentlichen Einfluss auf die Funktion von T-Lymphozyten.
In vielen Untersuchungen wurde gezeigt, dass bei PAIS das Zusammenspiel von T-Lymphozyten mit anderen Immunzellen fehlgesteuert ist. Eine häufig gefundene (aber sicher nicht allein notwendige und ausreichende) Konstellation ist auch eine funktionelle „Erschöpfung“ von T-Zellen (Yin et al. 2023, Gil et al. 2024).
2024 konnten Forscher der Columbia University demonstrieren, dass eine Aktivierung des Immunsystems im Körper Nervenzellen im Nucleus tractus solitarius, einem Kerngebiet des Nervus vagus im Hirnstamm, aktiviert, die ihrerseits wieder regulatorisch auf das Immunsystem zurückwirken (Jin et al. 2024). In diesem Regelkreis werden sowohl entzündungsfördernde als auch -hemmende Reaktionen vermittelt. Ein Jahr zuvor war bereits nachgewiesen worden, dass Signale, die über Nervenbahnen von den Rachenmandeln in den Hirnstamm geleitet werden, das Krankheitsverhalten bei einer Atemwegsinfektion auslösen (Bin et al. 2023). Immun- und Nervensystem kommunizieren also auf vielfältige Weise miteinander, um ihre Aktivitäten zum Wohle des Gesamtorganismus zu koordinieren (Überblick bei Leunig et al. 2025).
Offenbar gibt es im Gehirn auch einen vom Bewusstsein unabhängiges „Gedächtnis“ für Krankheitsvorgänge im Körper. Die sogenannte Inselrinde des Großhirns speichert Informationen zum anatomischen Ort und zur Art einer peripheren Immunantwort. Eine Reaktivierung der selben Nervenzell-Ensembles kann die Symptome der Erkrankung wieder hervorrufen, ohne dass die ursprünglichen Auslöser erneut vorliegen (Koren et al. 2021).
Krankheitsverhalten
Nicht nur das Fehlen von Gesundheit
Eine wesentliche Aufgabe des Gehirns ist es also, „Krankheitsverhalten“ zu produzieren bzw. zu koordinieren. Krankheitsverhalten (engl.: sickness behavior) ist nicht einfach die Einschränkung oder Abwesenheit von „normalem“ Verhalten und Leistungsvermögen, sondern ein eigenes Repertoire von überwiegend unbewusst produzierten Verhaltensweisen, die das Ausheilen und die Erholung von Krankheiten befördern sollen.
Nach dem Modell des „Predictive Processing“ unterhält das Gehirn ein auf bisher gemachten Erfahrungen basierendes, laufend aktualisiertes, vorausschauendes System von Annahmen oder Erwartungen darüber, was die wahrscheinlichen Ursachen von Sinneseindrücken sind, welche Handlungsmöglichkeiten der Körper und seine Umgebung bereithalten, was mit potentiellen Handlungen bewerkstelligt werden kann, und wie sich die Effekte dieser Handlungen auf den Organismus auswirken werden. Unter dem Einfluss dieser Annahmen konstruiert das Gehirn unser Erleben, anstatt Signale aus dem Körper und der Umgebung einfach zu empfangen und im Bewusstsein abzubilden.
In diesem Kontext kann beispielsweise eine verminderte Freisetzung des neuromodulatorischen Botenstoffs Noradrenalin aus dem Locus coeruleus im Hirnstamm zu einer veränderten Wahrnehmung des Maßes an Mühe führen, das das Gehirn der Ausübung von Aktivitäten beimisst, während es diese vorbereitet (Kaduk et al. 2022). Eine veränderte Aktivität im Hypothalamus kann sich auswirken auf das vegetative Nervensystem, die Steuerung der Körpertemperatur, den Wach-Schlaf-Rhythmus und auf integrative kortikale Strukturen, die mit der Wahrnehmung von Körperzuständen und dem subjektiven Wirksamkeitserleben („agency“) zu tun haben. Von der o.g. Inselregion ist bekannt, dass sie der wichtigste Knotenpunkt des Gehirns für die Interozeption ist, also die Art und Weise, wie unser Gehirn den inneren Zustand des Körpers interpretiert. Jones (2007) kam zu dem Schluss, dass Störungen der Interozeption der Wesenskern von post-infektiösen Fatigue-Syndromen sei.
Was aber, wenn immunologische Vorgänge im Gehirn selbst (das ja nicht nur aus Nervenzellen besteht, sondern zu einem beachtlichen Teil aus Zellen, die dem Immunsystem zugerechnet werden), eine anhaltende Veränderung des funktionellen Zusammenspiels von Hirnregionen bewirken, die maladaptiv sind? Was, wenn das Gehirn Krankheitsverhalten produziert, ohne dass dazu ein angemessener Grund besteht? Zum Beispiel, wenn eine Infektion schon lange vergangen ist, Immun- und Nervensystem aber nicht den Weg zurück zu einem „normalen“ Funktionieren finden?
Funktionelle Störungen
Noch ein möglicher Pathomechanismus
In diesem Fall kann ein Teil der Symptomatik eines PAIS oder ME/CFS manchmal auch hilfreich mit dem Konzept einer Funktionellen Neurologischen Störung (FNS) erklärt werden. FNS sind Ausdruck von „Missverständnissen" in der Kommunikation zwischen Nervensystem und Körper, und sie sind ausgesprochen häufig. Hier spielen, neben den biologischen, auch psychosoziale Faktoren eine wichtige Rolle. Zentral ist aber, dass auch nach konventionellem Medizinverständnis oder mit herkömmlichen Tests „unerklärliche“ Symptome natürlich real sind, und sich belastend auswirken.
Therapeutische Ansätze
Wie kann man Long COVID und ME/CFS behandeln?
Das „C“ in CFS steht für „Chronisch“. ME/CFS stellt also erfahrungsgemäß eine lang anhaltende Belastung dar. Je länger jemand mit ME/CFS lebt, umso mehr graben sich die Beschwerden in die Lebensrealitäten hinein, und hinterlassen Narben: in der Biologie, im Selbstverständnis, in der Biographie. Von daher ist „heilbar“ ein schwieriger Begriff. Aber ich bin überzeugt, dass Long COVID und andere PAIS sowie auch ME/CFS in vielen Fällen überwunden werden können, und nur in manchen Konstellationen – vielleicht derzeit noch – nicht.
Noch einmal die DGN, in ihrer Stellungnahme vom 22.07.2025: „Wichtig ist die Beratung von Betroffenen darüber, dass es bisher keine speziell für die Behandlung von ME/CFS zugelassenen Medikamente oder andere Therapieverfahren gibt. Durch den Mangel an evidenzbasierten wissenschaftlich gesicherten Daten können derzeit keine nichtzugelassenen medikamentösen Behandlungen empfohlen werden.“
Mit dieser Einschätzung stimme ich nicht überein. Die Beratung darüber, was es nicht gibt, erscheint mir nicht sonderlich hilfreich – auch wenn es natürlich die Versorgungsrealität widerspiegelt und bedeutet, dass für die meisten der existierenden Therapieformen (noch) nicht mit einer Kostenerstattung durch die Krankenkassen gerechnet werden kann. Aber natürlich empfehle ich „off-label“-Therapien. Wichtig erscheint mir allerdings, in deren großer Menge diejenigen zu finden, die im Einzelfall am ehesten erfolgsversprechend sind.
Es gibt bisher keine Belege, dass irgend eine Behandlungmodalität die beste für eine Mehrzahl von Patienten wäre. Behandlungsstandards existieren nicht. Die „Open Medicine Foundation“ hat im Rahmen des Treat ME Survey ca. 4.000 Long COVID- und ME/CFS-Patienten nach den subjektiven Effekten von 150 verschiedenen Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln und nicht-pharmakologischen Therapien auf ihr allgemeines Befinden sowie auf die Kernsymptome Fatigue, PEM, POTS, brain fog und nicht-erholsamer Schlaf befragt (Eckey et al. 2025). 21 Therapien führten in 30% und mehr der Anwendungsfälle zu mäßiger oder deutlich Besserung, weitere 41 Therapien konnten dieses Ergebnis in 20-30% der Anwendungsfälle erzielen. Insgesamt zeigte sich aber ein sehr variables Bild, was die Notwendigkeit unterstreicht, PAIS und ME/CFS ausgehend von den Bedürfnissen jedes Patienten individuell zu behandeln.
Eine Therapieform, die zum Erstaunen der Forscher nur von einem geringen Teil der Patienten versucht wurde, im Fall der Anwendung aber oft deutlich positive Effekte auf Fatigue, PEM und brain fog hatte, ist das Pacing.
Pacing
Die Grundlage
Pacing meint, Pausen zu machen, bevor man sie braucht. Mit seiner Energie so Maß zu halten, dass man möglichst viel von dem, was ansteht, erreicht, ohne diese charakteristischen extremen Erschöpfungszustände zu erleiden. Pacing ist essenziell, um eine Abwärtsspirale im Krankheitsverlauf zu vermeiden und den weiteren therapeutischen Ansätzen Raum zur Entfaltung ihrer Wirkung zu geben (Ghali et al., 2023). Als illustrierende Metapher kann ein Bankkonto mit einem empfindlich hohen Zinssatz auf den Dispo-Kredit dienen, dessen Inanspruchnahme daher möglichst vermieden werden soll, während man sich allmählich größere Spielräume erarbeitet. Pacing kann ganz elementar dazu beitragen die Bedingungen zu schaffen oder zu verbessern, unter denen Betroffene das Gefühl haben können, dass nicht die Erkrankung sie in der Hand hat, sondern umgekehrt sie die Kontrolle über die Erkrankung und ihr Leben haben oder wiedererlangen.
Mein Angebot
Kompetenz und Sorgfalt
Die Ausprägung von Long COVID ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Deshalb lege ich Wert auf ein ausführliches Gespräch und eine sorgfältige Untersuchung, die auch kognitive und vegetative Funktionsstörungen erfasst und die soziale und berufliche Situation der Patienten berücksichtigt. Die vollständige Anamnese aller Beschwerden wird durch Erfassungsbögen gestützt, die in aller Ruhe vor dem Termin ausgefüllt werden können. Bereits vorliegende Befunde werden eingeordnet, ergänzend sinnvolle Laboruntersuchungen können vereinbart werden, z.B. zur Unterscheidung von hypo- und hyperinflammatorischen Verlaufsformen oder zum Nachweis von Autoantikörpern und Störungen im zellulären Immunsystem. Die Diagnostik von Fatigue und CFS erfolgt anhand international anerkannter Instrumente und Kriterien. Die medizinisch fundierte Interpretation alle Befunde ist dann die Grundlage für eine individuelle Behandlungsempfehlung.
Bei der Erholung von Long COVID und anderen postinfektiven Fatigue-Syndromen korreliert die Anzahl der vorliegenden Symptome häufig mit der Zeit, die eine erfolgreiche Behandlung in Anspruch nimmt. Viele Betroffene, die anfangs mit einer kurzfristigen Erkrankung gerechnet haben, müssen ihren Lebensstil anpassen, um die schleppende Genesung zu bewältigen. Die Erkrankung ernst zu nehmen und den Patienten ihre Beschwerden "abzunehmen“ ist von grundlegender Bedeutung. Eine sorgfältige Aufklärung über die Erkrankung kann dazu beitragen, auch im Umfeld der Patienten eine unterstützende Akzeptanz herzustellen.
Die Behandlung zielt darauf ab, den Ursachen einer Immunaktivierung zu begegnen, Mangelzustände auszugleichen und Symptome der Erkrankung zu lindern. Bei Fatigue fokussiert die Behandlung zunächst auf Strategien zur Aufrechterhaltung der Alltagsfunktionen. Es ist wesentlich, Stress und Beanspruchungen über die anfangs oft engen Grenzen der körperlichen und geistigen Belastbarkeit hinaus zu vermeiden, um Kapazitäten für eine allmähliche Verbesserung des Leistungsvermögens zu gewinnen. Das Auftreten von PEM / PENE zu verhindern ist Voraussetzung der weiteren Genesung.
Es gibt zahlreiche Ansatzpunkte für die Behandlung von Schlafstörungen und Schmerzen, aber auch für die Störungen von Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnis, die Störungen der Regulation von Kreislauf und vegetativem Nervensystem und die Überaktivierung von Immunzellen, die hinter allergischen Beschwerden, Schmerzen und Verdauungsstörungen stehen kann. Welche Ernährungsformen, Medikamente, Mikronährstoffe, Hilfsmittel, Übungen und sonstigen Behandlungsverfahren im Einzelfall wirken, muss getestet und aufmerksam beobachtet werden.
Termine und Honorare
Termine erhalten Sie nach telefonischer Vereinbarung (Kontaktdaten siehe "Über mich"). Anfragen per E-Mail werden so rasch wie möglich beantwortet. Menschen mit eingeschränkter Mobilität biete ich telemedizinische Konsultationen an. Bei medizinischer Notwendigkeit und zeitlicher Verfügbarkeit führe ich auch Hausbesuche in der näheren Umgebung durch.
Ich bin kein Vertragsarzt der gesetzlichen Krankenkassen (wie AOK, BKK, Barmer u.a.). Als Privatarzt behandle ich Sie auf der Grundlage eines unmittelbar zwischen Ihnen und mir geschlossenen Behandlungsvertrags. Wir entscheiden gemeinsam, welche Diagnostik und Behandlung für Sie in Frage kommt. Dabei bin ich nur Ihnen und dem Stand der medizinischen Wissenschaft verpflichtet. Ich nehme mir für Sie die Zeit, die Sie brauchen.
Für meine Behandlung stelle ich Ihnen eine Rechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Für ein Erstgespräch von 60 Minuten, Untersuchungen und einen ausführlichen Bericht wird das Honorar etwa € 190 betragen, für weitere Termine (30 Min.) ca. € 130. Die Rechnung wird von deutschen Privatkrankenversicherungen oder der Beihilfe für Beamte in der Regel voll anerkannt und übernommen.
Kosten für bei (Spezial-) Laboren in Auftrag gegebene Untersuchungen werden von diesen direkt in Rechnung gestellt.
Dr. S. Kley